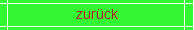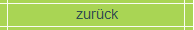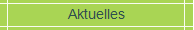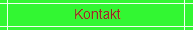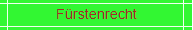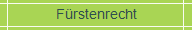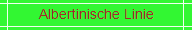Prof. Dr. Heinz Holzhauer
Münster, 27. März 2015
Daniel Prinz von Sachsen
Kötzschenbodaer Str. 19
01468 Moritzburg Friedewald
Sehr geehrter Herr von Sachsen,
Ihr Bericht über ein Gespräch mit dem Hauschef der ernestinischen Linie gibt mir Anlass, auf die von Ihnen
genannten Punkte einzugehen und deren Behandlung in meinem früheren Gutachten entsprechend zu
akzentuieren.
Punkt 1: Prinz Timo sei durch seine morganatische Ehe aus dem Haus der albertinischen Linie des Hauses
Wettin ausgeschieden.
Ich zitiere aus dem 1904 erschienenen, letzten und führenden Standardwerk von Hermann Rehm: „Auch
Verheiratung mit einer Unebenbürtigen bringt dem Agnaten nach gemeinem Fürstenrecht für seine Person
keinen rechtlichen Nachteil. Insbesondere verliert er nicht die Sukzessionsfähigkeit. Das Hausrecht eines
einzelnen Hauses kann anders bestimmen, tut es aber generell für Prinzen (anders: Prinzessinnen) in
Wirklichkeit nicht. Ausgeschlossen ist nicht, dass für den einzelnen Fall durch Individualgesetz oder im Weg
der Ausübung landesfürstlicher Hausgewalt Nachteile verhängt werden. Sie treten aber nicht von selbst ein...
Etwas anderes ist der freiwillige Austritt... “ (Modernes Fürstenrecht, 1904, S. 259.)
§ 10 des Königlich Sächsischen Hausgesetzes von 1837 bestätigt diesen Grundsatz des gemeinen
Fürstenrechts. Danach hat die Schließung einer nicht ebenbürtigen Ehe durch einen Prinzen des Königlichen
Hauses, „keine rechtliche Wirkung auf Stand, Titel und Wappen, Erbfolge in der Regierung, das
Hausfideicommiss und die Secundogenitur, auf Apanage, Aussteuer und Wittum“. Die hausrechtliche
Stellung der Prinzen bleibt danach in jeder Hinsicht unverändert, nur für die nicht ebenbürtige Ehefrau
bedeutet die Verneinung von Wirkungen, dass sie keine hausrechtlichen Rechte erwirbt. Auch Rehms
Mitteilung, dass es die theoretisch möglichen Ausnahmen von dem gemeinfürstlichen Grundsatz in der
Wirklichkeit nicht gibt, bestätigt sich im vorliegenden Fall. Ein morganatische Eheschließungen betreffendes
Individualgesetz gab es im Königreich nicht und die im Zweiten Abschnitt des Hausgesetzes geregelte
Hausgewalt des Königs gibt diesem keine entsprechende Befugnis gegenüber einem eine morganatische
Ehe schließenden Prinzen.
Die Kompetenz zum Ausschluss eines morganatisch verheirateten Prinzen aus dem Haus hätte allein bei den
Agnaten als den genuinen Trägern der fürstenrechtlichen Autonomie gelegen. Aber weder hat es seit
1837eine auf Verlust der Hausmitgliedschaft gerichtete Änderung des Hausgesetzes noch ad hoc gegenüber
Prinz Timo einen derartigen Beschluss der Agnaten gegeben. Es ist nicht einmal bekannt, dass Hauschef
Friedrich Christian seinen Neffen Timo nach dessen Eheschließung nicht mehr zum Haus gerechnet hätte.
Auch steht fest, dass Prinz Timo nicht seinerseits den Austritt aus dem Haus erklärt hat (Rehm a.a.O. (S. 259
unter 2.): „Etwas anderes ist der freiwillige Austritt...“.
Erst für Abkömmlinge aus der nicht ebenbürtigen Ehe ergibt sich aus § 14 des Hausgesetzes in Verbindung
mit § 6 der Verfassung des Königreichs Sachsen von 1831 der Nachteil fehlender Sukzessionsfähigkeit.
Dieser Mangel ist jedoch heilbar durch Beschluss der Agnaten („Jede unebenbürtige Ehe kann unter
Zustimmung aller Agnaten für vollwirksam erklärt werden, da das durch den Mannesstamm dargestellte Haus sein
Hausrecht für den einzelnen Fall durch eine Ausnahmesatzung abzuändern vermag.“ (Otto Gierke, Deutsches
Privatrecht Bd. I 1894, S. 404, zustimmend zitiert bei Rehm a.a.O. S. 198 f.)).
Bis zum Tod von Markgraf Maria Emanuel waren alle Agnaten dazu bereit, mit der einzigen Ausnahme des
Markgrafen, der mit der „Designation“ des 1999 von ihm adoptierten und seitdem den Namen Alexander
Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen tragenden Sohnes seiner Schwester höchst eigene, nicht
hausgesetzkonforme Ziele verfolgte. Diesen Sachstand dokumentiert der von den Agnaten, den Prinzen
Albert, Dedo und Gero, gemeinsam mit Prinz Rüdiger (und seinen Söhnen Daniel, Arne und Nils) am 10. 12.
2002 gefasste Beschluss, sich gegenseitig als vollwertige Agnaten des Hauses anzuerkennen; ferner wurde
beschlossen: „Die zur Zeit nicht als Hausgesetz konform eingestuften Ehen werden vom zukünftigen Hauschef
hiermit anerkannt und als ebenbürtig eingestuft. Im besonderen sind dies die Ehen von S.K.H. Timo ...mit
Margit Lucas vom 07. 08. 1952“. Dies geschah ausdrücklich im Bewusstsein, dass „diese Anerkennung zur
Zeit vom Chef des Hauses nicht mitgetragen wird" und daher vorerst nur im Innenverhältnis gilt. Nach dem
Tod von Markgraf Maria Emanuel am 23. 7. 2012 hat Prinz Albert, der neue Hauschef, am 22. 8. 2012 den
Beschluss vom 10. 12. 2002 „bestätigt und wiederholt“. Die Befugnis dazu hatte er als einziger noch lebender
Agnat.
Es gibt keinen hausrechtlichen Rechtsakt, der dadurch revidiert worden wäre. Die Nichtmitwirkung von
Markgraf Maria Emanuel an dem Agnatenbeschluss vom 10. 12. 2002 ist eine reine Tatsache.
Die entgegengehaltenen These, es gäbe keine nachträgliche Anerkennung einer Ehe, hat keine Stütze im
gemeinen Fürstenrecht. Freilich kann eine nachträgliche Anerkennung nur für die gegenwärtige Rechtslage
Bedeutung haben und hätte keine Rückwirkung auf entgegenstehende Rechte Dritter. Solche sind hier nicht
gegeben, auch nicht aus der Erbverbrüderung mit der ernestinischen Linie. Die Verbrüderungsformel am
Ende des „Hauptteilungsvergleichs des Jahres 1485“ knüpft den Eintritt der jeweils anderen Linie an das
Fehlen lediglich eines männlichen ehelichen Leibeserben (Hermann Schulze, Die Hausgesetze der regierenden
deutschen Fürtenhäuser, 3. Bd. 1883, S. 74 ff, S. 83), dies entsprechend der juristischen Lehre der Zeit, die das
conubium unter Freien nicht durch ein Ebenbürtigkeitserfordernis einschränkte ( Im Gutachten ausführlich
belegt.). Ein solcher ist in Prinz Rüdiger unabhängig von dessen Charakter als Agnat im haurechtlichen Sinn
vorhanden, so dass seine Legitimierung die Erbverbrüderungsberechtigten nicht verletzt.
Die Legitimierung der zunächst nicht hausgesetzmäßigen Ehe hat die Wirkung, dass die Abkömmlinge aus
der Ehe in die Sukzessionsfolge eintreten (Rehm a.a.O. S. 187 und öfter). Im Übrigen beruht die Anerkennung
von Prinz Rüdiger nicht allein auf der Legitimierung der Elternehe, weil er auch für seine Person in den
Beschlüssen von 2002 und 2012 als Agnat anerkannt worden ist.
Gleiches gilt von seinen Söhnen, den Prinzen Daniel, Arne und Nils. Einerseits ist in den genannten
Beschlüssen die Ehe von Prinz Rüdiger mit der Mutter legitimiert, anderseits sind die Prinzen jeder einzeln
als Agnaten anerkannt.
Punkt 2 betrifft die Möglichkeit, dass Prinz Daniel seinen Vater zu dessen Lebzeiten als Hauschef ablöst.
Obwohl das Königlich Sächsische Hausgesetz weder die Ausschlagung noch den Verzicht auf den Thron
regelt und die Verfassung nur Fälle der Verhinderung, kennt das gemeine Fürstenrecht beide Erscheinungen
und ist der Thronverzicht, die Abdankung, uneingeschränkt anerkannt (Rehm a.a.O. S. 400; Otto Mayer, Das
Staatsrecht des Königreichs Sachsen, 1909, S. 63 f. Ihm zufolge ist auch die Ausschlagung „allgemein angenommene
Lehre“. Anders, in doktrinärer Argumentation: Binding, Das Thronfolgerecht der Kognaten in Luxemburg, S. 20).
An der fürstenrechtlichen Zulässigkeit des Verzichts auf die Stellung als Hauschef ist kein Zweifel begründet.
An die Stelle tritt der Agnat, der in der Sukzessionsordnung an nächster Stelle steht, im vorliegenden Fall
Prinz Daniel.
Heinz Holzhauer
Nachtrag zum Gutachten von 2015